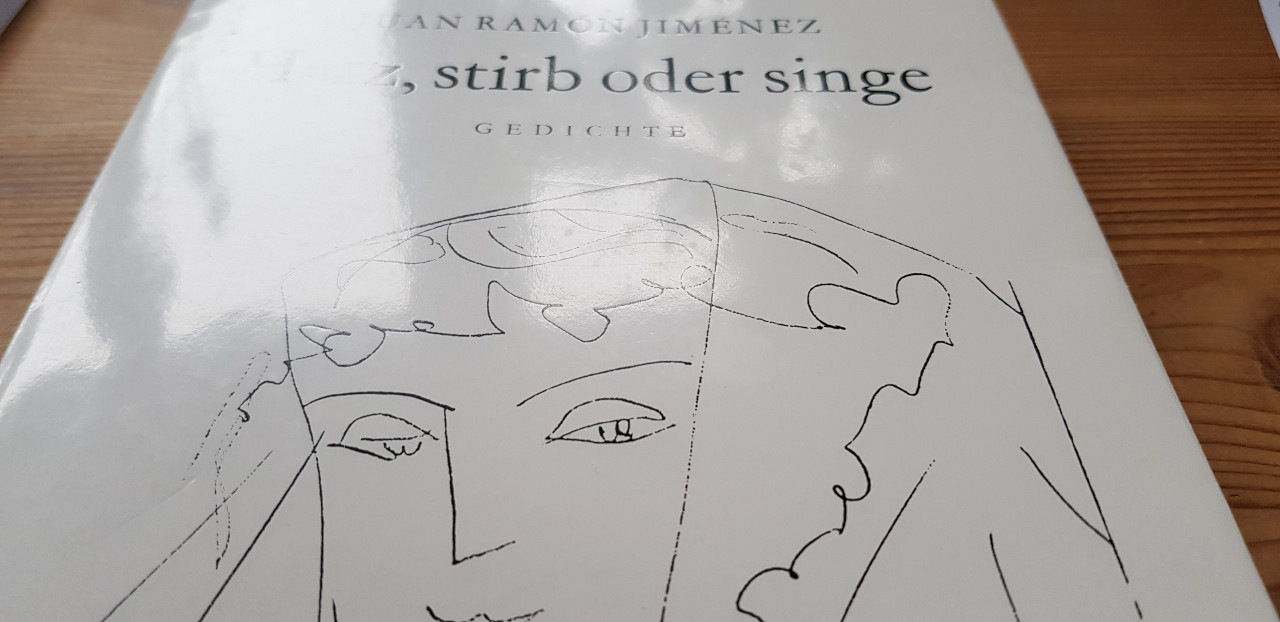Es ist ein Lächeln, das zum Grinsen wird, einem breiten, lang, sehr lang andauernden Grinsen, just in dem Moment, da Uri Caine den ersten Ton spielt, seinen Oberkörper dicht über das Fender Rhodes gebeugt, den Kopf dreht er zu Timothy Lefebvre, Timothys rechte Hand ruht noch an den Saiten seines E-Basses wie die Hand eines Cowboys in einem kitschigen Wildwest-Film am Halfter einer Pistole, entspannt, gespannt, bereit, bereit brummende, wabernde Bass-Salven abzufeuern, Timothy grinst jetzt ebenfalls, vielleicht weil er sich auf seinen Einsatz freut, vielleicht, weil er genauso fasziniert ist wie ich vom Tempo mit dem Zach Danziger auf sein Schlagzeug einpeitscht.
Es ist dieses Lächeln, das zum Grinsen wird, immer dann, wenn ich den Kopf drehe und in die Gesichter des Publikums schaue, das Lächeln der grauhaarigen, hageren Dame entdecke, die eben noch keine Miene verzog, das Programmheft zu einer Rolle gedreht, fest umschlossen in der linken Hand, so fest, also suche sie Halt in den Worten, mit denen das Bedrock Trio angekündigt ist, überrascht und lächelnd jetzt, da ihr zu gefallen scheint, was sie hört.
Es ist dieses Lächeln, das zum Grinsen wird, als ich das Kopfnicken des Studenten neben mir wahrnehme, eben noch erzählte er mir mit jenem amerikanischen Akzent, den ich erst nach ein paar Sätzen verstehe, von der Big-Band seiner Universität, mit der er morgen seinen Auftritt hier hat, er reckt sein Kinn unaufhörlich im Takt der Musik nach vorn, kleine Bewegungen sind es und doch scheint sein ganzer Kopf mitzunicken, seine Schultern zucken, fast schwindelig wird mir beim Zuschauen.
Es ist dieses Lächeln, das zum Grinsen wird, als ich ein tiefes, gebrummtes „Yeah, man!“ höre, es klingt so klar, dass ich fast glaube, es käme vom Band oder von einer CD, der CD irgendeiner Live-Aufnahme einer Jazz-Session in einem Club irgendwo in New York, vielleicht dem Village Vanguard, dort scheinen solche Rufe zu einem Konzert zu gehören wie die nahezu andächtige Stille zu Beginn eines Konzerts hierzulande.
E.S.T. steht für Esbjörn Svensson Trio – Dan Berglund – Magnus Öström – Esbjörn Svensson.
Es ist die Schwingung des Lautsprechers, auf dem ich sitze, zwei Armlängen hinter Esbjörn Svensson und seinem Flügel, nah, ganz nah, so nah wie ich später bei keinem Konzert seines Trios mehr an der Bühne sitzen konnte, wurden doch die Säle und Hallen mit jedem Auftritt des Trios größer, jene Schwingung, die mich mit den Zehen in meinem rechten Schuh im engen Raum zwischen Sohle und Kappe auf und ab wippen lässt, manchmal tappe ich mit dem ganzen Ballen auf den Boden, während mein linker Fuß ruht, fest auf dem Boden ruht, so wie meine linke Hand auf meinem Oberschenkel, während ich mit der anderen den Takt auf meinem Bein klopfe und immer wieder mit den Fingern das schnelle Spiel von Esbjörn Svensson auf dem Klavier nachzuahmen versuche, ab und zu unterbreche ich das Tappen, das Wippen, das Klopfen, das Fingerspiel, spüre nur die Schwingung jener Töne, die Dan Berglund mit seinen kräftigen Armen seinem Bass entlockt, er umschließt ihn fast ganz mit seinem Körper, er ist der einzige Kontrabassist, den ich kenne, der seinen Bass ab und an genau vor seinen Körper stellt und ihn umschließt, mit seinen Armen, wie sich eine Mutter vielleicht hinter ihr Kind stellt, ihm Sicht freigibt auf alles, was es erwartet, ihm den Weg freihält, wohin auch immer es gehen mag, und ihm doch den Rücken stärkt, es schützt.
Es ist diese Schwingung zwischen Esbjörn Svensson, Dan Berglund und Magnus Öström, die ich spüre, diese Schwingung, von der ich glaube, dass sie jeder spürt, der in diesem Raum sitzt oder steht und ihnen zuhört, diese Schwingung, mit der es ihnen wieder und wieder gelingt, ihre Stücke zu einem Atem beraubenden Tempo und Zusammenspiel hinaufzuschrauben, weiter, immer weiter, schneller, immer schneller, um plötzlich, abrupt, ein Stück enden zu lassen, wie ein Schnitt eine Szene in einem Film enden lässt, Schnitt, aus, neue Szene, nichts, nichts schwingt mehr nach, nichts scheint zu existieren in diesem Moment, nicht Zeit, nicht Luft, nicht Licht. Für den Bruchteil einer Sekunde ist alles, was schwingt mein Hirn, das mir vorgaukelt, jene Melodie noch hören zu können.
Es ist jene Schwingung, mit der das Esbjörn Svensson Trio ein Stück von Thelonious Monk spielt, nach ein paar Takten steht Esbjörn vom Flügel auf und ermuntert das Publikum, mit zuklatschen, er lacht, lacht ins Publikum, klatscht den Takt vor, setzt sich wieder, spielt weiter, alle lachen, Esbjörn, Dan, Magnus, das Publikum, lachend, klatschend, den Takt klatschend zu einem Monk-Stück, interpretiert von einem schwedischen Jazz-Trio irgendwo auf einem Jazz-Festival mitten in Deutschland.
Es ist jene Gelassenheit, die mich einnimmt, sobald Miles Davis die ersten Töne seines Solos von „So What“ in die Luft pustet, bestimmt und doch gelassen, wie ein Raucher vielleicht, der kleine Kringel in die Luft pustet, jene Gelassenheit, nach der ich mich so sehr sehne, an einem Tag, an dem ich die Tageszeitung mit all ihren schlechten Nachrichten zu früh gelesen habe, zu früh, noch bevor mein Kaffee dampfend und heiß vor mir steht, zu heiß, um getrunken zu werden, doch Duft ausströmend, diesen beruhigenden Duft, der mich stets mit dem Tag versöhnt, noch bevor er richtig begonnen hat.
Es ist jene Gelassenheit, die Paul Chambers mit seiner wundervollen kleinen Melodie am Bass in der ersten halben Minute von „So What“ in den völlig leeren Klangraum stellt, jene Gelassenheit, mit der ich meinen Wagen lenke, kupple, bremse, beschleunige, die Lautstärke meines CD-Spielers soweit aufgedreht, dass ich lautere Geräusche außerhalb meines Wagens noch hören kann, die Fenster geschlossen, die Klimaanlage sorgt für erträgliche 22 Grad an diesem viel zu heißen Vormittag im Juli auf der A7 irgendwo zwischen Hannover und Hamburg, ohne zu denken gleite ich dahin in meinem Wagen, schalte, kupple, lenke, bremse, beschleunige, hörend, sehend, was um mich herum geschieht.
Es ist jene Gelassenheit, mit der ich nur in meinem Wagen die Welt um mich herum wahrnehme und sie doch ausblende, jene Welt, die ich an diesem Tag ausschließen möchte aus meinen Gedanken, jene Welt, deren Sorgen ich nicht teilen mag, nicht heute, es ist diese Gelassenheit, mit der ich Teil nehme und mich doch entziehe, ein Solo spiele in diesem kleinen Abschnitt des Lebens, diesem winzigen Ausschnitt aus der Welt.
DaveBrubeck – Roland Godefroy – 1990 in Deauville
Es ist diese Freude, die Dave Brubeck mit seiner Frau teilt, als Zuhörer auf dem Konzert einer Band, die von strengen Kritikern freilich nicht unter Jazz eingeordnet würde, doch Dave Brubeck ordnet nicht ein, er wippt mit dem Fuß, wippt mit der Hüfte, stehend, sich festhaltend an einem Geländer in diesem Konzertsaal und an der Hand der Gattin, wippt mit der Hüfte, stößt mit der Hüfte leicht an seine Gattin, lachend, teilend, Freude teilend darüber, wie schön Musik ist, die sich längst nicht mehr in Kategorien einordnen lässt, Freude teilend, unwissend, mit mir, die ich jene Szene beobachte.
Es ist diese Freude, die jemand aus Dankbarkeit mit mir teilt, wenn eine Musikempfehlung so ganz unerwartet den Geschmack trifft, diese Freude, die ich in den Augen jener Menschen sehe, die sich auf Festivals, die das Etikett „Jazz“ tragen, plötzlich zu rockigen oder gar poppigen Klängen bewegen und sich nicht wundern oder wehren gegen das, was da mit ihnen geschieht, einfach so.
Es ist diese Freude, die verbindet, immer, überall, alles und jeden, diese Freude, die zu Glück wird, Glück, das Stunden eines Konzertes überdauert und Sekundenglück, das mich fahle, graue Momente des Alltags vergessen lässt, immer wieder. Es ist diese Freude, dieses Glück, diese Gelassenheit, diese Schwingung und dieses Lächeln.
Unstillbar.
Dieser Text ist 2015 erschienen, damals auf der blaue ritter.
Weitere private BlogTexte habe ich hier abgelegt.